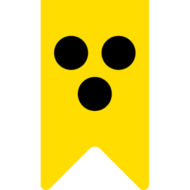Leseproben: (Ausschnitte aus verschiedenen Geschichten)
Farbenfrohe Dunkelheit
Kurzgeschichten und Gedichte von Sehbehinderten
und Blinden
Hrg. BLAutor-Mitglied Dieter Kleffner
Printausgabe: ISBN: 978-3-96174-100-7
März 2022
Format: 14,8 x 21 cm, Paperback, 288 Seiten
VK: 12,95€
Edition Paashaas Verlag, www.verlag-epv.de
Bettina Hanke: Das Versteck
„Jetzt geh schon!“, drängte Marlene. „Christopher möchte raus in den Schnee. Und ich hab hier
noch zu tun.“ Sie wies mit einer weitschweifenden Bewegung auf das schmutzige Geschirr und das
übrige Chaos in der Küche.
Ben grinste. Er wusste genau, was Marlene vorhatte. Immer meinte sie, schlauer als er zu sein. Nur
durchschaute er in Wahrheit sie und nicht umgekehrt!
„Ja, ja“, murmelte er, „ich geh schon!“ Er wandte sich der Tür zur Stube zu. „Christopher!“, rief er.
„Wir gehen raus und fahren ein bisschen Schlitten.“
Als Christopher die Tür der Hütte aufriss, schlug Ben Kälte entgegen. Eigentlich verspürte er keine
Lust, mit seinem Sohn im Schnee herumzutollen. Doch andererseits … Wieder grinste er.
Sollte Marlene seinetwegen die gesamte Hütte auf den Kopf stellen. Sie würde nichts finden …
Ben trottete seinem übermütig kreischenden Sohn hinterher zu dem kleinen Schuppen. Dort
lagerte nicht nur das Scheitholz, sondern auch ein alter Schlitten und ein paar Schneeschaufeln.
Unter dem weit hinausragenden Dach hatten sie das Auto untergestellt, so dass es zumindest nicht
eingeschneit wurde.
Marlene spähte aus dem Fenster. Ihr Sohn stolperte durch den Tiefschnee. Ohne Mütze, ohne
Handschuhe. Warum bloß merkte Ben sowas nicht? Manchmal benahm er sich wie ein zu groß
geratenes Kind. Marlene seufzte. Ja, manchmal hatte sie zwei Kinder. Vor allem dann, wenn es bei
Ben wieder soweit war.
Als die beiden im Schuppen verschwanden, wandte Marlene sich dem Durcheinander in der Küche
zu. Hastig beseitigte sie das gröbste Tohuwabohu. Und sie stapelte das verdreckte Geschirr neben
der Spüle. Das musste warten. Sie hatte etwas Wichtigeres zu tun …
Sie begann auf dem Dachboden, wo sich das Schlaflager befand. Wobei Schlaflager in Anbetracht
der winzigen Hütte ein maßlos übertriebener Ausdruck war. Aber Rudi neigte allgemein dazu,
sich aufzublähen und seinen Mund viel zu voll zu nehmen.
„Immerhin hat er uns die Hütte überlassen“, beschwichtigte Marlene sich selbst und sah sich
genau um. „Und hier gibt es weit und breit keine Kneipe und kein Restaurant!“
Auf dem Dachboden schien es keine Möglichkeit zu geben, etwas zu verstecken. Keine Schränke,
keine Balken, hinter denen sich Hohlräume verbargen. Nur eine schlichte, niedrige Bank, die sich
unter der Dachschräge über die lange Seite der Wand erstreckte. Darauf hatten sie ihre Taschen
abgestellt und ihre Kleidung ausgebreitet.
Die Matratzen lagen auf einer Art Paletten knapp über dem Boden. Marlene hob ein paar der
Matratzen an. Nichts. Aber ein gutes Versteck gäben sie schon ab. Also alle durchsuchen! Auch
unter der letzten Matratze fand sich nichts als Staub.
Marlene eilte die Treppe hinunter. Ob Ben und Christopher noch beschäftigt waren? Sie warf einen
Blick aus dem Fenster.
Die beiden rasten den kleinen Abhang jenseits der Mulde hinunter, Christopher mit Bens Mütze
auf dem Kopf. Sie hatten sich offenbar eine Bahn gewalzt, denn im Tiefschnee hätten sie nie eine
solche Geschwindigkeit erreicht. Sie schienen viel Spaß zu haben mit dem Schlitten. Gut so. Damit
blieb ihr noch Zeit.
Als nächstes durchsuchte Marlene die Stube. Hier gab es einen mächtigen Schrank und ein
raumhohes Regal, das aussah wie selbstgezimmert. Sie durchkämmte das Regal mit ihren Blicken.
Unmengen an verstaubter Deko. Ein paar CDs. Abgegriffene Bücher. Eine Spielesammlung.
„Ich weiß, dass du es versteckt hast!“, knurrte Marlene und riss die erste Schranktür auf. Nichts!
Sie öffnete eine Tür nach der anderen, bis sie den gesamten Schrank durchsucht hatte. Nichts.
Sie durchwühlte die beiden großen Schubladen unter der wuchtigen Tischplatte. Vergebens.
Sie drehte jedes einzelne Kissen um. Sie klopfte die Holzwände nach geheimen Hohlräumen ab.
Sie untersuchte den Boden auf eine Falltür hin. Nichts.
Sollte sie sich getäuscht haben? Marlene sank auf die Bank. Nein, sie irrte sich nicht …
Wenn Ben so drauf war, dann hamsterte er. Dann sammelte er wie ein Eichhörnchen. Dann
bereitete er sich auf den nächsten Absturz vor. Und dass er kurz davor stand, das war
offensichtlich. Marlene kannte die Zeichen.
Das verräterische Zittern seiner Hände. Seine Gereiztheit. Seine Rastlosigkeit. Die geistige
Abwesenheit. Alles wies auf die herannahende Katastrophe hin.
…
Dieter Kleffner: Das Märchen vom Radfahrer
Es war einmal ein Radfahrer, der sich mit seinem klapprigen Klapprad auf einer Radtour befand.
Die Sonne brannte vom blauen Himmel. Die Beinmuskeln schmerzten bereits und Schweiß stand
dem jungen Mann auf der Stirn. Fern rollte Donner, obwohl der Wetterbericht kein Gewitter
angekündigt hatte. Sturm, dunkle Wolken und Blitze kamen bedrohlich nah. Der Radfahrer
flüchtete sich in einen finsteren Waldweg. Der Regen prasselte so unerbittlich auf das Blätterdach,
dass dieses die Wassermassen bald nicht mehr halten konnte. Der Bursche entdeckte in einem
zerklüfteten Hügel einen schmalen Höhlenzugang. Er stellte sein Fahrrad auf den Ständer und ging
vorsichtig wenige Schritte in die Höhle hinein. Diese felsige Behausung bot ihm einen trockenen
Unterstand. Weiter hinten führte der schmale Gang in ein bedrohlich dunkles Nichts.
Der Radfahrer schaute wieder zum Ausgang. Der Regen verschleierte die Weitsicht. Vor der Höhle
bedeckten schwarze Wolken anscheinend eine Waldlichtung. Der Radfahrer kniff die Augen zu
Schlitzen und schaute genauer hin. Auf der Lichtung dehnte sich ein geheimnisvoll grüner Teppich
aus. Dort wuchs kein Strauch, kein Baum. Nein – dort war keine Wiese, kein Gras. Algen bedeckten
die Oberfläche eines Tümpels. Vermutlich war es sogar ein kleiner See. Bei dieser Sicht konnte das
Auge das andere Ufer nicht erkennen. Auch der nahe Wald verschwand im nebeligen Nichts.
Donner und Blitze rollten und zuckten fast gleichzeitig. Das Zentrum des Unwetters stand über
der Höhle und dem See. Die Luft war schwer und schwül. Die prasselnden Regentropfen ließen
das Gewässer kochen. Es wirkte geheimnisvoll und gefährlich. Der Radfahrer musste in diesem
Moment an das Ungeheuer von Loch Ness denken. Die Tropfen auf seiner Stirn waren kein
Regenwasser mehr, sondern nur noch Schweiß. Er atmete tief durch und zwang sich zur Ruhe.
Plötzlich schoss hinter ihm aus dem Dunkel der Höhle ein riesiger Hund hervor und knurrte. Seine
gefletschten Reißzähne waren lang und gelb. Hätte das Untier drei Köpfe gehabt, so wäre es dem
Höllenhund Cerberus noch ähnlicher gewesen.
Bevor der Radfahrer gebissen werden konnte, flüchtete er zum steil abfallenden Ufer und wagte
einen gewaltigen Hechtsprung ins grüne Wasser. Mit diesem Schwung stieß er tief bis zum Grund
des feuchten Elements vor. Dort ertastete er etwas, das nicht hierher gehörte. Die Form des
Gegenstandes wirkte glatt, rechteckig und bestand aus Metall.
Ach … Die neugierigen Finger hatten eine alte Waschmaschine entdeckt, die hier wohl von einem
naturfeindlichen Menschen entsorgt worden war.
Jetzt wurde die Sicht im Wasser hell und klar. Hatte sich das Unwetter so rasch verzogen, wie es
gekommen war? Der Radler erschrak. Obwohl es hier unten keinen Strom geben konnte, begann
die Maschine zu vibrieren. Die Trommel bewegte sich. Sie drehte sich – erst langsam, dann
schneller und schneller. Der junge Mann tauchte tiefer und schaute in das gläserne Bullauge.
Oh – unglaublich – eine kleine Meerjungfrau joggte in der Trommel wie in einem Hamsterrad. Dem
Radler ging der Atem aus. Geschwind entriegelte und öffnete er noch die gläserne Tür der
Maschine, stießt sich vom schlammigen Boden ab und durchstieß mit letzter Kraft die
Wasseroberfläche. Er spuckte Wasser wie ein Wal und rang nach Atem.
Der Himmel hatte sich während seines Tauchgangs beruhigt. Die Wolkendecke riss auf und
machte der Sonne mehr und mehr Platz. Als sich der Wasserschleier in den Augen des
Schwimmers auflöste, erschien vor ihm das anmutige Gesicht einer Meerjungfrau. Ihre nackten
Brüste wippten in den seichten Wellen. Das zauberhafte Geschöpf schlang die Arme um seinen
Hals und sagte mit lieblicher Stimme: „Vor langer Zeit bin ich aus Neugier in die Waschtrommel
geschlüpft. Ein dummer Fisch hat die Tür zugestoßen, und das Schloss ist automatisch eingerastet.
So war ich bis heute in der Trommel gefangen. Du hast mich aus diesem Gefängnis befreit und
deswegen nun einen Wunsch frei.“ Sie schaute dem Retter erwartungsvoll in die Augen. Er
wendete den Kopf zur Höhle, wo der Höllenhund immer noch neben dem Klapprad saß und
knurrend seine riesigen Zähne zeigte.
Die Augen des jungen Mannes richteten sich wieder auf die märchenhafte Nixe, deren goldenen
Haare sich im Wasser wie ein Schleier bewegten. Ihre Zunge fuhr einladend über die herzförmigen
Lippen.
Seine Schwimmbewegungen wurden zappelig. Ihm war im Wasser heiß und kalt zugleich. Seine
Augen fürchteten den Blick zum alten Fahrrad, das immer noch vom Bruder des Cerberus‘
bewacht wurde.
Verschämt fragte er: „Darf der Wunsch auch ganz außergewöhnlich sein?“
„Wünsch dir, was du willst und es wird erfüllt.“
„Gut, dann wünsch ich mir ein neues Mountainbike mit einer hydraulischen Bremsanlage,
gefederter Vordergabel und einem superleichten Carbon-Rahmen!“
Enttäuscht verschwand das Lächeln der Nixe. Doch schon bald blickte sie ihm noch einmal voller
Hoffnung tief in die Augen. „Wenn ich dir noch einen zweiten Wunsch gewähren würde, was
würdest du dir dann wünschen?“
„Dann wünsche ich mir zusätzlich die besten Sportschuhe für die Klickpedalen!“
Die schöne Nixe spritzte ihm einen Wasserschwall ins Gesicht und löste sich wie eine schillernde
Seifenblase in Nichts auf.
Marc Mandel: Wer mit Eifer sucht
„Vorgestern. Das Gespräch dauerte fast fünfzig Minuten.“
Melanie Thalbachs Gesicht verfärbt sich.
Franziska Schygulla blickt auf Zahlenkolonnen. Es sind die Telefongespräche der
Mitarbeiterinnen ihres Reisebüros. Drei arbeiten hier vorne im Laden. Melanie sitzt hinten, in dem
kleinen Büro.
„Gestern. Elf Uhr zehn. Über eine halbe Stunde. Die gleiche Nummer.“
Melanie Thalbach weiß nicht, wo sie hinschauen soll. „Ich kann dazu jetzt nichts sagen.“
Franziska Schygulla lächelt: „In beiden Fällen handelt es sich bei dem Gesprächspartner um einen
Herrn Dominik Walster. Ein Freund von Ihnen?“
Melanie kennt dieses Lächeln. Sie weiß, dass es nichts Gutes bedeutet. „Seit vorgestern sind wir
zusammen. Ich war die Nacht bei ihm. Als ich ihn zum ersten Mal sah, am Samstag, in der Disco,
das haute mich um. Er schaute mich an. Aber ich wusste vorher schon, dass ich mich in ihn verliebt
hatte. Als er mich, also, als ich gestern dann bei ihm war, mein Herz wurde immer kleiner. Aber
warum sage ich Ihnen das? Die langen Telefonate mit ihm, das wird nicht mehr vorkommen. Es
war eine Ausnahme.“
„Beruhigen Sie sich. Sie wissen, dass Sie in dieser Hinsicht von mir Verständnis erwarten können.
Andererseits werden Sie von mir ausgebildet. Und bezahlt. Vierzig Stunden in der Woche.
Abzüglich der Zeit in der Berufsschule. Wenn Sie ganz alleine in Ihrem Büro sitzen, möchte ich
mich darauf verlassen können, dass Sie private Dinge in Ihrer Freizeit erledigen.“
„Selbstverständlich, Frau Schygulla.“
„Sehen Sie es so: Während Sie im Hause sind, befindet sich Ihr Rucksack meist unter dem
Schreibtisch. Dabei möchten Sie doch sicher sein, dass niemand hineingreift, um Geld aus Ihrer
Börse zu stehlen. Insoweit müssen wir uns gegenseitig vertrauen. Dass niemand dem anderen
etwas wegnimmt. Mit dem Telefon ist es ebenso. Sind wir uns einig?“
„Natürlich, Frau Schygulla.“
„Vergessen Sie nicht, Ihre Sachen aus dem Büro zu holen. Ich wünsche Ihnen ein schönes
Wochenende.“
Mechanisch greift Melanie nach der ausgestreckten Hand.
Dass die Schygulla so rumzickt. Wegen zwei Telefongesprächen. Dabei ist sie bloß sieben Jahre
älter. Das betont sie doch dauernd. Aber wenn man erstmal verheiratet ist, dann sind sieben Jahre
eben sieben Jahre. Total nett sei sie, hat Melanie ihrer Freundin vorgeschwärmt. Noch letzten
Montag. Weil die Schygulla immer fröhlich ist. Weil sie wie ein Model aussieht, mit den langen
blonden Haaren, den flippigen Klamotten, den High-Heels. Es ist dieses professionelle Lächeln.
Deshalb hat sie die Schygulla bisher so nett gefunden.
Mit einem Spurt erreicht sie die letzte Tür der Straßenbahn, stolpert beim Einsteigen, stülpt den
kleinen Rucksack um, verteilt ihre Habseligkeiten auf dem Boden. Drei Fahrgäste helfen ihr beim
Einsammeln.
Melanie will an etwas anderes denken. Sie versucht, die Ohrstöpsel ihres IPods zu entwirren.
Künftig wird sie Dominik nur noch über das Handy anrufen. Schon zwei Stationen? Sie steigt aus.
Immer noch benommen.
„Ey, alte Drecksau.“ Ihre Freundin Nadine.
Sie küssen sich. „Dich brauche ich heute. Voll der Aggress.“
„Wir gehen ins Kiss. Ich spendier dir einen ‚Sex on the Beach‘.“
Auf einer Videowand singt Beyoncé. Melanie wühlt in ihrem Rucksack; die Geldbörse ist weg. „Da
war meine EC-Karte drin.“
„Hat dich jemand beklaut?“
„Ich weiß nicht. Meine Chefin, die hat eben so eine komische Bemerkung gemacht.“
…
Sara Rietz: An den Sonnenstrahl
Oh, mein Sonnenstrahl, du leuchtendes Licht,
du berührst mich warm, wenn der Lenz anbricht,
streichelst mein Gesicht zärtlich und so leicht,
dass Freude gleich mein müdes Herz erreicht.
Jag von mir fort diese quälende Nacht,
lass mich wiedersehn alle Frühlingspracht:
Knospen und Blumen, Baum, der mir gefällt,
zeig‘ mir die Farben all der schönen Welt.
Verleihe mir Kraft, denn ich hab‘ stets Schmerz,
wenn auf kein Licht mehr hoffen kann mein Herz,
komm und tröste mich, gesegneter Strahl,
so vermindert sich leichter wird die Qual.
Paula Grimm: Übertötung statt Overkill
Am Abend des 07. Juli 1969 sitzt Gesken auf ihrem Bett. Ihr Zimmer ist ein schmaler Raum. In ihm
stehen nur das Bett und ein Regal mit ihren Sachen. Er hat keine Tür. Gesken kann in die Küche
sehen. Die Küchentür ist offen. Ihre Mutter sitzt mit einer Illustrierten am Küchentisch. Der Geruch
ihres schweren, süßen Parfums dringt Gesken in die Nase. Gesken hört den Wagen ihres Vaters
auf den Hof fahren. Der Vater stellt den Motor ab, bleibt aber wie immer noch kurze Zeit im Auto
sitzen. Die Autotür wird zugeschlagen, die Schritte des Vaters kommen auf das Haus zu. Er öffnet
die Haustür und geht in die Küche. Sein Geruch nach kaltem Rauch und Rasierwasser steigt ihr in
die Nase.
Er wirft das Feuerzeug und die Zigarillos auf den Tisch. Er will erst einmal in Ruhe rauchen.
„Dass du es nur weißt, ich verlasse dich und den ganzen Scheiß hier!“
Diesen Satz hat die Mutter schon sehr oft gesagt. Aber bisher ist der Satz nie allein gewesen, ist
immer in einem der vielen Wortgefechte gesagt worden, die die Eltern sich täglich geliefert haben.
Auch der Tonfall ist anders als sonst. Der Satz stellt sich klar und deutlich zwischen ihre Eltern.
Der Vater merkt die Veränderung auch und hält inne. Er hat Gesken den Rücken zugedreht.
„Hast du gehört, was ich gesagt habe?“, keift die Mutter.
Der Vater nickt heftig und fragt: „Ist da ein anderer Kerl im Spiel?“
Ein kurzes, spitzes Lachen ist die Antwort.
Die Mutter springt auf. Jetzt stehen sich die Eltern Auge in Auge gegenüber. Das lässt plötzlich alle
Gefühle, die sie gegeneinander gehegt haben, los. Gleichgültigkeit, Machtgier, Zorn und
Geltungssucht wirbeln herum. Ein Sturm, der Gesken erfasst, keinen Platz mehr für ihre Gefühle
lässt, sie erstarren lässt aber ihre Wahrnehmungen schärft wie nie zuvor.
Dann beginnt der Vater in der Küche umherzugehen. Er holt Schwung für etwas, das noch nie da
gewesen ist.
Gesken hört, wie er an der Anrichte inne hält, sich plötzlich umdreht und auf die Mutter zuspringt.
„Dass du es nur weißt, einen Viktor Eisenbeiß verlässt man nicht!“
Gesken sieht das Messer in seiner Hand aufblitzen, hört den langen Schrei der Mutter und wie sie
auf den Boden fällt. Wieder und wieder sticht der Vater auf die Mutter ein. Bald schreit und bewegt
sie sich nicht mehr. Gesken sieht das Blut, das Messer, die Hand des Vaters und sein Gesicht.
Seine Bewegungen sind so schnell und heftig, dass sie Gesken und das gesamte Erdgeschoss
besetzen. Daher kann sich Gesken nicht mehr bewegen. Mehr noch. Gesken kann gar nicht mehr
reagieren. Denn auch der metallisch süßliche Geruch nach Blut, der die anderen Gerüche
beherrscht, lähmt Gesken.
In der Raserei bleibt das Gesicht des Vaters nicht unbewegt. Es hält mit der Hast des übrigen
Körpers Schritt. Schnell leuchten Zorn, gekränkte Eitelkeit über die Zurückweisungen seiner Frau,
Bosheit und Zerstörungswut in seinem Gesicht auf. So heftig und hastig diese Gefühle in seinem
Gesicht auftauchen und wieder verschwinden, ist da in der ganzen Zeit auch etwas, das
gleichbleibt. Es ist wie ein dünnes Netz vor seinem Gesicht, das vor Genugtuung und
Selbstzufriedenheit glänzt.
So plötzlich die Raserei angefangen hat, so plötzlich ist sie wieder vorbei. Dann ist das Gesicht des
Vaters ganz leer. Das Messer fällt klirrend zu Boden. Aber er selbst fällt nicht um.
Er steht lange da. Sein Ausdruck wird ganz ruhig. Er bückt sich nach dem Messer, nimmt es an
sich, grinst und geht an der Leiche der Mutter vorbei, die Treppe in den ersten Stock hinauf.
Gesken hört, dass er sich duscht, einige Sachen packt.
Er kommt mit einem Koffer in der Hand wieder herunter, nimmt die Schlüssel, geht hinaus. Kurze
Zeit später hört Gesken den Vater wegfahren. Es dauert, bis sie sich wieder bewegen kann,
begreift, dass da niemand mehr ist, der sie zerstören kann.
Plötzlich war da die andere Stille, eine Stille, wie sie in Sälen herrschen kann. Doch es war nicht
ganz genau die Ruhe, die Dr. Sidney Frederick von seinen kriminologischen Vorträgen kannte, und
die er gern selbst erzeugte. Dazu stellte er immer eine Frage, und zwar so, dass niemand in seinem
Publikum vor Spannung oder eingeschüchtert zu antworten wagte.
Dass die Stille den Experten des FBI aus dem weißgestrichenen Haus in Jensum und vom 07. Juli
1969 wieder in den Hörsaal und zum 08. Juli 1987 zurückführte, dauerte seine Zeit. Endlich war
Dr. Frederick im Stande auf die aufgeschlagene Seite des Notizbuchs zu blicken, das vor ihm lag.
Oben stand: „Übertötung, Übertötung, Übertötung“.
…