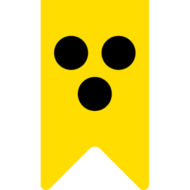Wie ich nach Bonn kam
Anneliese Useldinger
Bevor ich nach Bonn kam, war ich in Deutschland herumgezogen. So konnte ich mir damals nicht vorstellen, hier für immer zu bleiben. Aber das Leben hatte es wohl anders für mich geplant. Inzwischen sind bereits 45 Jahre vergangen, das Alter hat mein Herumtreiben auf gelegentliches Träumen von anderen Welten begrenzt, und so werde ich wohl hier mein Erdendasein beenden.
Als Albino mit hochgradiger Sehschwäche hatte ich nach einem Musikstudium, abrupt beendet durch die Währungsreform 1948, in einigen Berufen experimentiert mit dem Ergebnis, dass mein Sehrest nicht ausreichte. Als mein Vater 1958 an Lungenkrebs erkrankte und sein Tod schon absehbar war, musste ich mich darum kümmern, eine eigene Existenz aufzubauen. Der Weg zum Arbeitsamt in Trier resultierte in der einzigen Empfehlung: Umschulung in der Landesblindenanstalt in Neuwied. Kurz vor dem Examen vor der Industrie- und Handelskammer schickte man mich wieder zum Arbeitsamt, diesmal auf der Suche nach einer Stelle als Stenotypistin. Natürlich wollte ich nicht nach Hause, nicht nach Trier, sondern in eine größere Stadt.
Musik und Fremdsprachen sind etwas miteinander verwandt. Inzwischen hatte ich mich mit Englisch und Französisch beschäftigt und Gefallen daran gefunden. Daher schwebte mir vor, im Auswärtigen Amt in Bonn eine Stelle zu finden, um meine Sprachkenntnisse erweitern und entfalten zu können. Doch mein Antrag bei dieser Behörde wurde abgelehnt. Viel später erfuhr ich durch einen blinden Sachbearbeiter, dass der Beamte, der meine Bewerbung zu Gesicht bekommen hatte, kurz zuvor eine blinde Telefonistin hinauskomplimentieren musste, weil sie den Anforderungen in der Telefonzentrale dieses hohen Amtes nicht gewachsen war. Und der hatte sich geschworen: einmal eine Blinde, nie mehr eine Blinde! Aber es gab noch andere Ministerien, und das nicht gerade wenige.
In meinem Leben klappt fast nichts beim ersten Anlauf, es müssen deren mehrere unternommen werden, und es kommt gar nicht so selten vor, dass auch nach fünf oder zehn solcher Anläufe der Erfolg ausbleibt. Ich musste lernen, damit zu leben.
Es meldete sich das damalige Bundesschatzministerium und lud mich zum Vorstellungstest am 7. Juli 1960 in eine alte Villa am Rheinufer in Bad Godesberg ein. Nach all dem Büffeln und Üben auf Schreib- und Blindenschrift-Stenomaschine in Neuwied fiel es mir nicht schwer, diese Hürde zu nehmen. Eine Planstelle gab es zwar noch nicht, aber ich durfte trotzdem am 1. August in der Bauabteilung des Bundesministeriums in Bonn-Nord anfangen.
Nun erhob sich die Frage der Unterkunft. Vor 14 Jahren wollte ich in Köln an der dortigen Musikhochschule studieren, konnte jedoch bei der sehr schwierigen Nachkriegswohnungssituation mit ausgedehnten Trümmerfeldern und meinem Mangel an Kompensationsmitteln, wie z.B. Lebensmitteln, Bohnenkaffee und ähnlichem absolut keine Bleibe finden, ahnte jedoch nicht, dass ich nach einigen Jahrzehnten hier in Bad Godesberg heimisch werden sollte –
Für Neuzugänge gab es im Personalbüro des Ministeriums eine Liste mit Zimmerangeboten. Überrascht und dankbar nahm ich die Gelegenheit wahr, mit einer netten Dame, eigens dazu beauftragt, mit mir zu einem gerade frei gewordenen Zimmer zu fahren und möglichst gleich zu mieten. Ein älteres Ehepaar in Grau-Rheindorf bot dieses Zimmer im 1. Stock an. Es war ziemlich verwohnt, dagegen meine Ansprüche bescheiden, die Leute freundlich und der Weg zu meiner neuen Dienststelle in knapp 20 Minuten Fußweg ohne große Schwierigkeiten zurückzulegen. Nun kam der Hammer, als es um die Miete ging. Die Hausbesitzer wollten tatsächlich die ganze Miete von 70 Mark für den gerade begonnenen Monat Juli von mir haben, also im voraus, wogegen nach damaligen Gepflogenheiten nichts einzuwenden war. Aber ich war arm wie eine Kirchenmaus. Während der knapp zwei Jahre meiner Ausbildung in Neuwied bekam ich im Monat mal eben 30 Mark Taschengeld. Das reichte nicht für mal eine Tasse Kaffee oder einen Friseurbesuch, denn ich musste alle 14 Tage nach Hause fahren und meine Mutter besuchen, deren Witwenrente zu ihren Ungunsten falsch berechnet war, was erst nach mehreren Jahren herauskam – sie betrug noch keine hundert. Mark. Die Landesblindenanstalt in Neuwied war zu meiner Ausbildungszeit in einem unglaublich schlechten Zustand. Wir hungerten mitten im Wirtschaftswunder, weil die Bücher gefälscht wurden und das Geld in falsche Taschen verschwand. Das Blindengeld von damals 110 Mark verschlang die Schule total. Ich hatte niemanden, der mir mal mit ein paar Mark ausgeholfen hätte. Und jetzt sollte ich dieses Vermögen von 70 Mark aufbringen, für nichts und wieder nichts, nur damit ich am 1. August einziehen konnte. Ich erklärte verschämt meine prekäre finanzielle Lage und bat um Verständnis und Entgegenkommen. Diese Leute hatten alles im Leben gehabt, nichts verloren, der einzige Sohn in guten Verhältnissen als Geschäftsmann; sie waren eifrige Kirchgänger, aber die christliche Nächstenliebe war für sie ein Fremdwort. Schließlich einigten wir uns auf den halben Mietpreis von 35 Mark für den Juli, was für mich immer noch ein Vermögen bedeutete. Ich weiß heute nicht mehr, wie ich dieses viele Geld auftreiben konnte, nur eines ist sicher: ich habe es nicht gestohlen. Als ich am 1. August zu meiner Dienststelle ging, hatte ich gar kein Geld mehr. Nach meinen kleinen Umzügen von Konz bei Trier nach Neuwied und dann mit meinen „sieben gebackenen Birnen“ nach Bonn waren die letzten Pfennige aufgebraucht.
Wiederum verschämt fragte ich die sehr netten Damen im Büro, ob ich wohl um einen Gehaltsvorschuss bitten könne. Die Sekretärin des Unterabteilungsleiters riet mir, das besser zu lassen, da es für den Anfang einen schlechten Eindruck mache. Sie bot mir an, bis zum Gehaltsempfang am 15. des Monats 20 Mark zu leihen, damit ich wenigstens mittags in der Kantine essen konnte. Das habe ich ihr nie vergessen. Als mir nach noch nicht drei Monaten eine andere, eine richtige Sekretärinnenstelle in Bad Godesberg angeboten wurde, habe ich, zwar mit Bedauern wegen der selbständigen Arbeit und des höheren Gehalts abgelehnt und meine Probezeit bis zum Ende und noch viele Jahre mehr im öffentlichen Dienst durchgestanden, was ich nicht zu bereuen habe. Nach den ersten zehn Tagen in Rheindorf hörte ich an diesem Mittwochnachmittag – ich war noch nicht lange vom Büro zurück in meiner altmodischen, aber geräumigen Behausung – von der Straße her Musik und Lachen. Auf meine Frage nach dem Grund dieser werktäglichen Veranstaltung wurde mir berichtet, dass nach altem Brauch die Kirmes zu Ende ging mit dem Tanz auf der Straße. Der Zacheies, eine lebensgroße monströse Puppe, war der stumme Star der ganzen Chose. Jeder musste mit ihm tanzen, wie es sich gerade ergab, und wehe dem, der ablehnte. Das kostete Runden in der Wirtschaft, wohin sich die müden und durstigen Tänzer zum Abend hin begaben. Bei Einbruch der Dunkelheit wurde dann der Zacheies auf einen Schubkarren geladen und in Richtung Rheinufer gefahren. Dort steckte man ihn in Brand und übergab ihn den nassen Fluten des Stromes, natürlich mit viel Geschrei und Gejohle. So erlebte ich Rheindorf als Keimzelle Bonns und Hort alten Brauchtums. Einmal war ich auf einem Erkundungsgang in Richtung Hafen unterwegs. Mit meinem kleinen Sehrest fand ich mich nicht mehr zurecht, ich hatte zuviel gewagt. Da plötzlich sprach mich mein Hausherr an. Er war mir besorgt nachgegangen und brachte mich jetzt von meinem Irrweg wohlbehalten zurück zu seinem und auch meinem Domizil. In meinem möblierten Zimmer machte ich einige kuriose Entdeckungen: Die Matratze des breiten Bettes war auf ihrer Unterseite von einem dicken schwarzen Hakenkreuz gezeichnet, und sie machte bei der geringsten Drehung Musik. Vielleicht kam sie aus Wehrmachtsbeständen? Die Couch quietschte ganz erbärmlich, sogar bei ruhigem Sitzen. Ich war nicht die einzige Untermieterin in diesem Haus. Die Bekanntschaft mit meiner Nachbarin direkt nebenan geschah auf eine ungewöhnliche und schreckliche Weise. Eines Abends konnte ich nicht einschlafen, weil das Radio von nebenan immer ein bisschen lauter wurde. Es war bereits Mitternacht, da hörte ich ein Stöhnen. Sofort stand ich auf und suchte den Hausherrn. Er kam schnell und öffnete die Tür mit seinem Schlüssel. Da lag sie mitten in einem Selbstmordversuch. Die Ambulanz wurde gerufen und war nach wenigen Minuten da. Man trug sie hinunter. Wir standen noch ziemlich ratlos da und forschten nach einer Ursache für dieses Geschehen. Niemand wusste, was dieses junge Mädchen zu einer solchen Tat veranlasst haben könnte. Am nächsten Tag war das Zimmer ausgeräumt, und der besorgte Hausvater zeigte mir die völlig durchnässte Matratze – vielleicht auch mit Hakenkreuz? Er bedauerte, dass diese Unterlage nicht mehr zu gebrauchen war. Dieses Erlebnis wurde für mich zum Signal, mich schnellstens um eine Bundeswohnung zu kümmern. Und die flog mir zu. Schon nach wenigen Tagen konnte ich umziehen. Später, als die dort noch vorhandene Zweitmieterin ausgezogen war, kam eine blinde Freundin aus Koblenz hinzu. Die Pro-Kopf-Quadratmeter der Bundeswohnungen waren knapp bemessen, zumal für Ledige. Ich habe nicht mehr erfahren, was aus der lebensmüden Zimmernachbarin geworden ist. Noch dreimal bin ich in Bonn umgezogen. Nach Duisdorf und Endenich kam ich nach Bad Godesberg. Ich hatte diesen Stadtteil gewählt, weil meine Dienststelle dorthin umziehen sollte, aber das war nur ein Gerücht. Und dennoch, ich war hier endlich angekommen. Bonn bietet ein reiches Kulturleben, viele Gelegenheiten zur Freizeitgestaltung und ist mit einer guten Infrastruktur versehen. Wenn ich von irgendwoher zurückkomme, spüre ich immer wieder die starke Anziehungskraft dieses Magneten, an den ich mich gebunden habe und nicht mehr loskomme.
Danke, Bundesstadt Bonn, dass es dich gibt!
(c) Anneliese Useldinger / Bonn
Zurück zur Seite Anneliese Useldinger
Zurück zur Seite Vita und Werke
Zurück zur Startseite
Wie ich nach Bonn kam
BLAutor – Arbeitskreis blinder und sehbehinderter Autoren – www.blautor.de